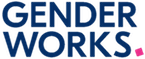69. Berlinale goes Diversity
Auf der diesjährigen Berlinale wurden mehr Filme von und mit Frauen im Wettbewerb gezeigt als jemals zuvor und als bei allen anderen renommierten Filmfestivals. Und es gab so tolle beeindruckende Filme mit so viel Diversity und Frauenpower, die ich einfach empfehlen muss - in der Hoffnung, dass sie nochmal im Fernsehen oder in Programmkinos laufen.
Die Berlinale ist phantastisch! Eigentlich bin ich gar keine Cineastin und gehe für gewöhnlich auch eher selten ins Kino. Aber die Berlinale… wunderbar! Das Abenteuer, aus über 400 Filmen jene auszuwählen, die mir interessant erscheinen. Das Fiebern beim Kauf der Tickets: Wird es klappen morgens Punkt 10:00 Uhr am Rechner? Nach erfolgreicher Jagd dann diese vielen herum wuselnden und -irrenden Menschen vor den Kinos. Menschen, die alle möglichen Sprachen, um mich herum. Proppenvolle Kinosäle bis in die erste Reihe. Filme in noch nie gehörten Sprachen. Schließlich die Spannung, ob der Film so sein wird, wie ich ihn mir aufgrund der Beschreibung vorgestellt habe.
Dieses ganze Beiwerk ist schon speziell. Aber am besten ist: Die Macher*innen der Filme sind auch mit dabei! Sie erzählen der Vorführung Näheres zur Entstehung oder Motivation und beantworten Fragen. Ich habe dadurch so viel Interessantes und Neues erfahren, wodurch ich den jeweiligen Film gleich noch besser fand!
Deshalb möchte ich hier vier Filme wärmstens empfehlen:
Meine Lieblingssektion der Berlinale ist das NATIVe Indigenous Cinema, dessen Filme schon mal per se voller Diversität sind. Vor zwei Jahren lag der Schwerpunkt auf der Arktis - mit unglaublich beeindruckenden Filmen voller unwirtlicher weißer Landschaften. Dieses Jahr standen der Pazifik und die Südsee im Mittelpunkt. Eine Region über die ich so gut wie nichts weiß und deshalb so glücklich über diese Schwerpunktsetzung bin.
Der Eröffnungsfilm war Vai, was ein Frauenname ist, der in den verschiedenen Sprachen der pazifischen Inseln „Wasser“ bedeutet. Noch während ich nach dem Film ganz in den einzelnen Episoden über Vai versunken war, kamen plötzlich neun (!) Frauen auf die Bühne: Die Filmemacherinnen! Diese Frauen hatten letztes Jahr in einer Workshopwoche die Grundidee für den Film entwickelt. Das Feintuning haben sie anschließend per Skype und Slackchat vorgenommen - denn alle Frauen wohnen auf verschiedenen Pazifikinseln ziemlich weit voneinander entfernt. Die jeweiligen Episoden von Vai wurden dann mit den Schauspielerinnen - bis auf eine alles Laiinnen! - an nur einem Tag gedreht.
Cool! Beeindruckendes Konzept! Und so viel Frauenpower! Das haben wohl nicht alle Zuschauer*innen verkraftet, denn ein Mann aus dem Publikum fragte doch tatsächlich, ob es da keinen Zickenkrieg gegeben hätte…
Die Macherinnen erzählten dass ihre jeweilige Episode auch eine persönliche Geschichte ist, entweder ihre eigene oder die ihrer Mutter oder Großmutter. Obwohl die Inseln unterschiedlich sind und jede ihre eigene Sprache hat, war allen gemeinsam, dass die Mädchen nach Neuseeland zur Schule oder Universität gingen und vielfach anschließend dort arbeiteten, um ihre Familien zu unterstützen. In Neuseeland sind sie Minderheiten, gelten als „Wilde“ - versuchen ihren Platz zu finden. So erzählt der Film von Tradition und Moderne, Trennung und Vereinigung, Kolonialismus und Selbstbehauptung, Fiktion und Realität. Auf eine so anrührende und bewegende Weise, dass ich ihn am liebsten gleich nochmal gesehen hätte.
Nur eine Frau stand hingegen im Mittelpunkt von Merata: How Mum Decolonised The Screen
Das Berührende an diesem Film lag für mich auf zwei Ebenen:
Zum einen natürlich an Merata Mita selbst. Sie war nicht nur die erste Maori-Regisseurin. Sie war auch die erste, die öffentlich im Neuseeländischen Fernsehen über Tabus wie Diskriminierung von alleinerziehenden Maori-Frauen oder über Abtreibung geredet hat. Sie filmte die Proteste der Maori gegen die Landeinnahme durch die Regierung ebenso wie die gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Maori. Die Widerstände und die Bilder der 1970er Jahre ähneln stark jenen aus Soweto in Südafrika - und sind gleichermaßen dadurch motiviert.
Merata Mita war eine Kämpferin mit der Kamera. Sie hatte fünf Kinder von drei verschiedenen Vätern und starb 2010 plötzlich mit nur 68 Jahren.
Und das ist die zweite sehr berührende Ebene dieses Films: Ihr jüngster Sohn Hepi drehte diesen Film, in dem er vor allem seine älteren Geschwister interviewt hat. Er ist mit Abstand das jüngste Kind, geboren und aufgewachsen, als seine Mutter und sein Vater bereits erfolgreich im Filmgeschäft waren. Seine Geschwister hingegen wuchsen in Armut mit Rassismus aufgewachsen. Sie haben die Kämpfe der Mutter um Dekolonisierung nicht nur miterlebt, sondern auch durchlitten: Diskriminierung, Hausdurchsuchungen, Polizeigewalt und Verhaftungen waren allgegenwärtig. So erzählt der Film nicht nur die Geschichte einer beeindruckenden Frau, sondern er erzählt sie durch die Augen der Kinder. Sehr bewegend sind die Interviewsequenzen, wenn die Geschwister von dem Leid erzählen, dass sie durch den Kampf der Mutter ertragen mussten - und gleichzeitig mit Tränen in der Stimme Stolz und Dank ausdrücken.
Hepi Mita und seine ältere Schwester erzählten nach der Vorführung, wie die Dreharbeiten sie alle zusammen gebracht hat, wie sie sich erstmals über ihre jeweiligen Erinnerungen und Wahrnehmungen ausgetauscht haben. Wie Hepi mit dem Film versucht hat der Geschichte seiner Mutter, seiner Familie und seiner Herkunft näher zu kommen - und wie viele Frage für ihn dabei dennoch offen geblieben sind.
Mein drittes Filmhighlight ist der philippinische Film Busong, ebenfalls ein episodischer Film über Mythen und Realitäten der Palawan. Faszinierend fand ich nicht nur die unglaublich schönen Landschaftsaufnahmen, sondern auch hier die Verbindungen von Tradition und Moderne im Leben der Palawan. Erschreckend und unfassbar wiederum waren Szenen von Rassismus und Diskriminierung: Zum Beispiel als ein weißer Inselbesitzer einem einheimischen Fischer verbietet, in seinem „Privatgewässer“ zu fischen und dem Fischer das Boot wegnimmt. Dieser macht sich mit seinem kleinen Sohn nun auf den Rückweg zu seiner in der Ferne erkennbare Heimatinsel: Aufgrund der aufsteigenden Flut zunächst zu Fuß, dann seinen Sohn tragend, dann mit ihm schwimmend, dann jeder für sich schwimmend. Plötzlich ist der Sohn verschwunden und der Vater kann ihn nicht mehr wiederfinden.
Der in Manila aufgewachsene Regisseur Kanakan-Balintagos erläuterte nach der Vorführung, dass seine palawanische Mutter nie über ihre Herkunft berichtete und diese als Makel verleugnete. Das Leben und die Mythen der Palawan filmisch festzuhalten, bedeutete für ihn auch, die Kultur sichtbar und bekannt zu machen - damit sie nicht vergessen wird.
Meine letzte Filmempfehlung kommt aus der Sektion Panorama: Flatland.
Vielleicht ein bisschen weniger an „Thelma und Louise“ angelehnter Krimi und Roadmovie als die Ankündigung vermuten lassen würde. Dafür aber eine erschreckende Gesellschaftsstudie des heutigen Südafrika in der ländlichen konservativen Region der Karoo.
Was mich für den Film eingenommen hat, waren zweifelsfrei diese phantastischen Frauenfiguren. Allen voran die schwarze Polizistin Beauty in ihren rosa und hellblauen Nicki-Trainingsanzügen, die unerschrocken und aus Liebe zum vermeintlichen Mörder der Aufklärung des Mordes nachgeht. Auch die Teenager Nathalie und Poppy die aus ihren jeweiligen Zwängen auf einem Pferd entfliehen wollen, sind hervorragend.
Schwer erträglich fand ich hingegen den Post-Apartheit-Rassismus kombiniert mit Sexismus, der umso erschreckender war, weil er nicht laut und offensichtlich daher kam, sondern recht leise, aber dafür allgegenwärtig und durchdringend: alle reden Afrikaans, auch wenn Beauty Englisch bevorzugt; Nathalie und Poppy verstehen sich als Schwestern, obwohl Nathalie’s Mutter die Nanny von Poppy war (immerhin durfte sie Nathalie bei sich behalten!). Nach dem Tod der Mutter heiratet Nathalie einen Weißen, weil sie keine Unterkunft mehr hat, denn Poppy’s Tante will das „N*-Girl“ nicht mehr im Haus haben; sie lässt auch Beauty „wegen der Hunde“ nicht auf ihr Grundstück und schon gar nicht in ihr Haus…
Obwohl der Film als Drama erscheint hat er für die beteiligten Frauen jeweils ein ebenso überraschendes wie glückliches Ende. Auch das eine Besonderheit, die ich super fand!